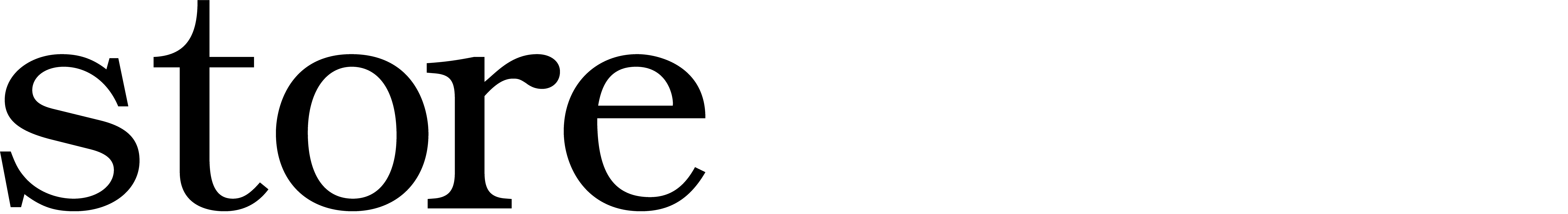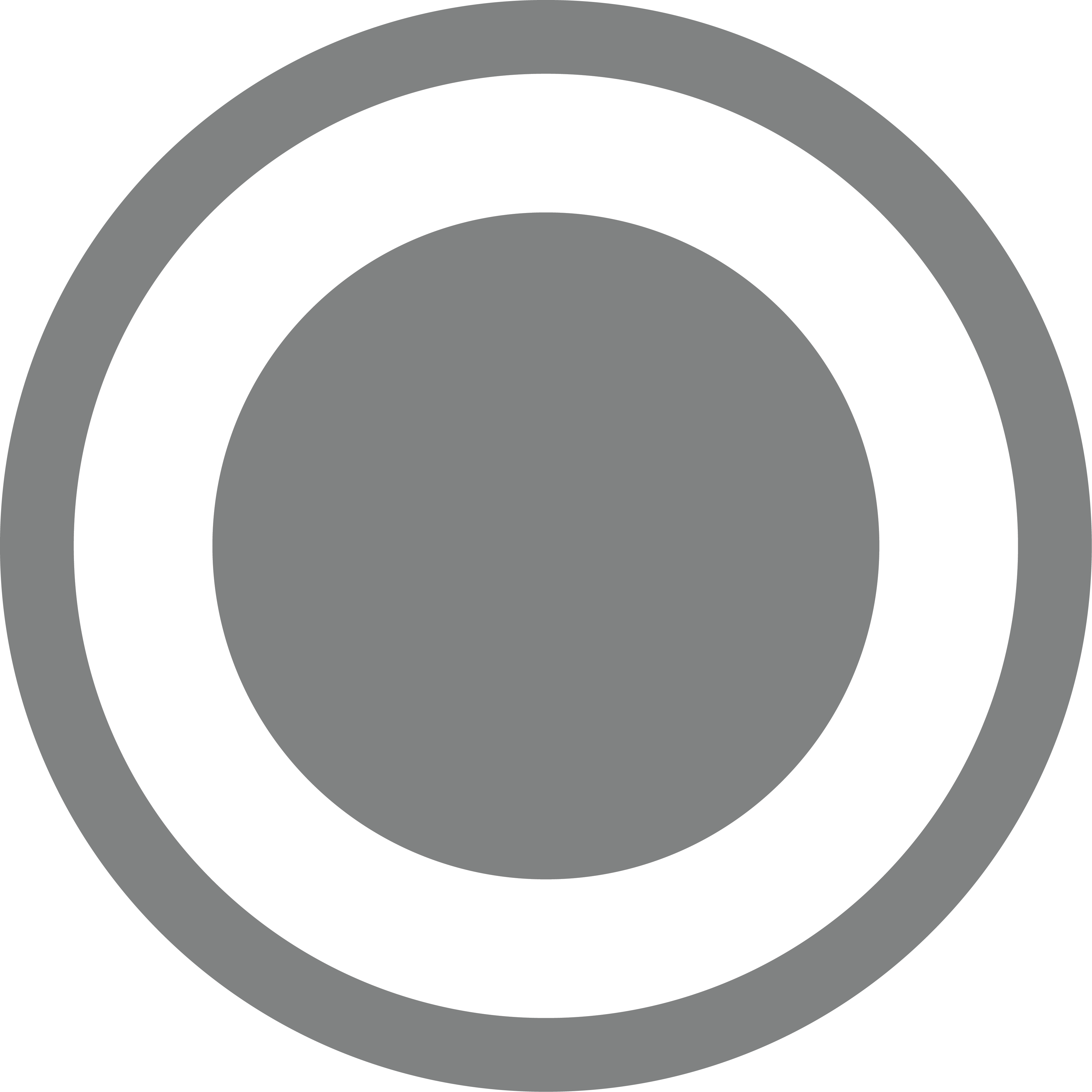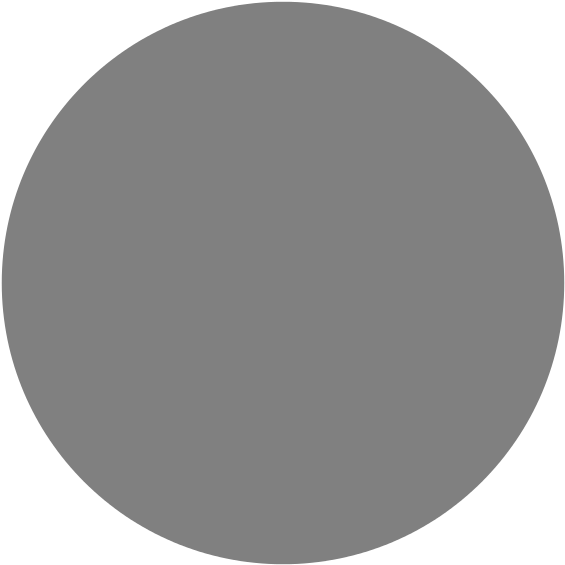Akku Dell XPS 15z |
Posted: October 20, 2014 |
Passend zu Nvidias neuer Maxwell-Generation hat Schenker das XMG P505 vorgestellt: Das Gaming-Notebook basiert auf dem P651SE-Barebone von Clevo und ist eines der leistungsstärksten Geräte seines Typs, denn der 15,6-Zöller ist nur rund 2,5 cm hoch und wiegt gerade einmal 2,5 kg. Anders als beispielsweise dem Razer New Blade steht dem Schenker XMG P505 deutlich mehr Platz zur Kühlung der verbauten Komponenten wie dem Haswell-Vierkern-Prozessor und der Maxwell-Grafikeinheit zur Verfügung. Das nutzt der Hersteller außerdem für bis zu vier SSDs oder Festplatten, darunter sogar Samsungs XP941 und maximal 32 GByte DDR3-Speicher. Bei dem uns von Schenker zur Verfügung gestellten Vorserienmuster des XMG P505 gibt es noch unfertige Elemente wie zu große Spaltmaße und eine nicht aktive WLAN-Karte, Verarbeitung und Materialwahl des Clevo-Barebones überzeugen aber. Ein Großteil des Gerätes, beispielsweise die Handballenablage, besteht aus Aluminium statt aus Kunststoff. Die Verwindungssteifheit ist hoch, der Displayrahmen ist - wie oft bei Notebooks - leicht zu verbiegen.
Hinsichtlich der Anschlüsse gibt es bei Schenker mehr als beim Durchschnitt: Auf der rechten Seite befinden sich ein Kopfhörerausgang, ein Mikrofoneingang, ein optischer S/PDIF, zwei USB-3.0-Ports, Ethernet-LAN, der Kartenleser, ein SIM-Schacht und eine Öse für ein Kensington-Schloss. Links sind zwei Mini-Display-Ports, ein HDMI-Ausgang und ein weiterer USB-3.0-Anschluss sowie ein Teil der Belüftungsschlitze. Auf der Rückseite pustet die Kühlung einen Großteil der heißen Luft hinaus, hier sitzt ein kombinierter USB-3.0-/eSATA-Port, auch das Netzteil wird hinten angeschlossen. Mit einem Bausatz namens Pi-Top soll künftig jeder sein eigenes Notebook zusammenschrauben können. Auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo sammeln die Macher des Projekts gerade Geld für die Produktion. Erreichen sie ihr Ziel von 80.000 US-Dollar, bekommen die Käufer für knapp 200 Euro offene Hardware und einen Bauplan an die Hand. Bisher sind die Entwickler auf einem guten Weg: Rund 44.000 Dollar haben sie innerhalb von 24 Stunden eingesammelt, für den Rest haben sie noch 30 Tage Zeit. Das Pi-Top basiert auf dem Mini-Rechner Raspberry Pi B+. Das Gerät ist so breit wie eine Scheckkarte und kostet im Handel knapp 35 Euro. In der Vergangenheit vergnügten sich vor allem Tüftler damit: Sie verwandelten den Raspberry Pi in Mediencenter und Router, in sprachgesteuerte Kaffeemaschinen oder den Spinnenroboter Charlotte. Beim Pi-Top ist der Raspberry Pi der Kern eines ganzen Notebooks. Zusätzlich ist im Bausatz ein Display mit einer Bildschirmdiagonalen von 13,3 Zoll enthalten, ein Gehäuse, eine Tastatur mit Trackpad sowie Kabel und ein Wifi-Controller. Wer möchte, kann sich das Gehäuse auch selbst am 3-D-Drucker herstellen, die entsprechende Datei liegt dem Bausatz ebenfalls bei.
Der Pi-Top arbeitet mit einem auf 700 Megahertz getakteten Prozessor und 512 Megabyte Arbeitsspeicher. Außerdem hat er vier USB-Anschlüsse, einen HDMI- und einen Audioausgang. Eine Festplatte im herkömmlichen Sinne gibt es nicht. Beim Raspberry Pi wird das Betriebssystem auf eine SD-Karte installiert, der übrige Speicherplatz ist dann für Dateien und Anwendungen gedacht. Auf dem Pi-Top wird das freie Betriebssystem Raspbian OS laufen. Entwickler mit Bildungsauftrag Die Leistung des Rapsberry Pi B+ reicht laut Testberichten für Schreiben, Surfen, Musikhören und Videoschauen in HD. Für aufwändige Games, Fotobearbeitung oder Videoschnitt ist der Minirechner hingegen zu schwach. Das Notebook ist daher vor allem für den Bildungsbereich und einfache Anwendungsbereiche interessant. Den Entwicklern ging es aber auch nicht darum, ein Gerät für aufwändige Bildbearbeitung oder Spiele zu schaffen. Im Vordergrund stehe das Ziel, Menschen beizubringen, wie sie Hardware herstellen können, schreibt Jesse Lozano, einer der Mitgründer des Pi-Top-Projektes, in einer E-Mail an ZEIT ONLINE. Die Leute sollen am Ende mehr über die eingesetzte Hardware, zum Beispiel die Controller für Trackpads oder den Displayschaltkreis wissen. Mit diesem Wissen werde es ihnen wiederum möglich sein, die Hardware auch für andere Zwecke zu nutzen, schreibt Lozano. Auf Basis des Notebooks einen Roboter programmieren Das Zusammenschrauben des Pi-Top soll also nur der erste Schritt sein. Mithilfe von Bildschirm-Lektionen können Nutzer lernen, wie sie weitere Hardware herstellen können. Die Basis dafür ist der Pi-Top. Anschaulich wird das an dem Konzept der HATs: So nennen die Entwickler Module, die Nutzer zusätzlich kaufen können. Die Module kommen in Form einer Platine und werden im Pi-Top auf den Raspberry Pi geschraubt. Dort können sie dann so programmiert und modifiziert werden, dass sie anschließend zur Heimautomatisierung oder für als Steuerungseinheit für kleine Roboter verwendet werden können.
Ob das Handy in der Hosentasche in Flammen aufgeht oder die Batteriepacks einer Boeing: Kurzschlüsse in Lithium-Ionen-Akkus sind zwar selten, aber gefürchtet. Deshalb entwickelten Forscher aus den USA und China jetzt ein simples Frühwarnsystem für solche Extremschäden. Eine hauchdünne Kupferfolie zwischen den Elektroden hilft frühzeitig erkennen, wenn durch Metallablagerungen im Innern ein Kurzschluss droht. Die Schicht lässt sich in gängige Lithium-Ionen-Akkus integrieren, berichten die Forscher im Fachblatt Nature Communications. Dabei soll die Methode vermutlich weniger in der jährlich milliardenfach verkaufte Kleinelektronik vom Mobiltelefon bis zum Laptop eingesetzt werden – denn dort entfallen viele Schäden auf minderwertige Billig-Ersatzakkus. Wichtiger dürfte die Methode im wachsenden Markt von Elektroautos und Groß-Energiespeichern etwa für Windenergie sein: Dafür werden hunderte Akkuzellen zusammengeschaltet, eine einzige defekte könnte den gesamten Batterieblock in Brand setzen. Die Wahrscheinlichkeit für solche Kurzschlüsse liegt vielleicht bei eins zu einer Million, erklärt Yi Cui, Professor für Materialforschung an der Stanford University, doch wir wollen die Zahl von Batteriefeuern auf eins zu einer Milliarde senken – oder vielleicht sogar auf Null. Immerhin hatte Sony 2006 Millionen von Lithium-Ionen-Akkus zurückgerufen, nachdem rund ein Dutzend Laptops ihretwegen in Flammen aufgegangen waren. Und Boeing ließ 2013 seine neuen 787 Dreamliner-Modelle am Boden, nachdem in zweien davon die Akkupacks Feuer gefangen hatten. Herzstück des neuen Frühwarnsystems ist eine hauchdünne Kupferschicht, mittig zwischen den Elektroden herkömmlicher Lithium-Ionen-Akkus. Diese bestehen aus einer Kohlenstoff-Anode und einer Lithium-Metalloxid-Kathode, umspült von einer Elektrolytlösung. Nur eine dünne Polymer-Trennschicht separiert die beiden, lässt aber die Lithium-Ionen während des Lade- oder Entladevorgangs hindurch. Neben Defekten der Trennschicht kann auch zu schnelles Aufladen oder Laden bei Kälte zu Kurzschlüssen führen, erklären die Forscher: Überladen bringt Lithium-Ionen dazu, sich an der Anode anzulagern und Dendriten wachsen zu lassen. Diese können die poröse Trennschicht durchbohren und schließlich den Kontakt zur Kathode schließen. Die beim Kurzschluss entstehende Hitze wiederum kann den brennbaren Elektrolyten entzünden.
Funktionsschema des Akku-Kurzschluss-Frühwarnsystems: Im herkömmlichen Aufbau (links) fällt die Spannung erst auf Null, wenn die Dendriten die gesamte Strecke zwischen Anode und Kathode überwunden haben. Mit zusätzlicher Kupfer-Elektrode (rechts) ist der Spannungsabfall schon nach der halben Strecke messbar. Wolle man noch sicherer gehen, lasse sich die Kupferschicht noch näher an die Anode bringen, erläutern die Forscher. Im Prinzip lasse sich die Frühwarntechnik auch in Zink-, Aluminium- und anderen Metalloxid-Batterien nutzen: Es funktioniert in allen Batterien, in denen ein Kurzschluss entdeckt werden muss, kurz bevor sie explodieren. Allerdings nur bei Dendriten-Problemen, wie sie während des normalen Lade- und Entladebetriebs auftreten. Nicht erkannt werden Probleme durch Risse, verunreinigtes Material oder Kurzschlüsse etwa durch Sturzschäden.
Wie funktioniert eine Batterie? Wie teuer ist Strom aus Batterien? Wie entsorgt man leere Batterien? Fazit: Günstige Batterie hält am längsten
Auf Anfrage von Markt verweist Varta auf eigene Studien und hält das Ergebnis für nicht aussagekräftig. Aldi schreibt, man habe sich mit Panasonic, dem Hersteller der Top-Craft-Power-Batterien, in Verbindung gesetzt: Leider war es unserem Lieferanten nicht möglich, die Untersuchungsdetails umfassend auszuwerten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||